3.5 Arten und Lebensräume (Karte 1.4)
3.5.1 Beschreibung
080 Nördliche Frankenalb
Die Nördliche Frankenalb ist hinsichtlich ihrer Nutzungsverteilung durch das geologisch bedingte kleinräumige Hügel-, Fels- und Kuppenrelief im Wechsel mit flachen Mulden und Verebnungen geprägt: Die Felskuppen und steilen Hänge tragen kleinflächige Wälder gemischten Bestandes (bäuerliche Waldnutzung), während die Muldenlagen i. d. R. ackerbaulich genutzt werden. Nach Norden hin nimmt im Naturraum der Waldanteil deutlich ab. Ausgedehnte Waldbereiche (Flächenanteil insgesamt 42,7 %) beschränken sich auf den Veldensteiner, den Schnabelwaider und den Lindenhardter Forst. Bis auf wenige Grünlandbereiche sind die ehemaligen Hutungen der unteren Talhangbereiche in den eng eingekerbten und gewundenen Tälern von Pegnitz, Aufseß, Püttlach und Wiesent heute weitgehend von Laub- und Mischwäldern bestanden. Durch die Aufgabe der Grünlandnutzung dringt der Wald auch in den Talbereichen vor. Im nordöstlichen Bereich des Naturraums tritt die Ackernutzung gegenüber dem Grünland zurück.
Naturnahe Pflanzengesellschaften finden sich auf den Flächen, die auf Grund der Topographie oder fehlender Ergiebigkeit einer Bewirtschaftung entzogen sind (z.B. Felsköpfe, Dolomitkuppen, Höhlen oder Dolinen), in Grenzbereichen zwischen Wald und landwirtschaftlichen Nutzflächen (trockene Waldsäume), sowie auf ehemaligen Hutungsflächen. Die Vegetation ist auf Grund der geologischen und topographischen Vielgestaltigkeit des Naturraumes vor allem im Bereich der Krautflora sehr artenreich. Die Jurahänge in ihren verschiedensten Expositionen bilden z. T. ideale Mikrostandorte. Dies schlägt sich auch in der Anzahl und Verbreitung der amtlich kartierten Biotope nieder.
Flächenmäßig dominieren xerothermophile Kalkmagerrasen (Wacholderheiden, 16,3 %), Gebüschgesellschaften, Hecken (31,2 %), Feldgehölze und Raine an den Ackerterrassen sowie Waldränder im kleinstrukturierten Übergangsbereich zwischen Talraum und Kuppen. Vegetationsbestände feuchter Standorte treten dagegen flächenmäßig deutlich in den Hintergrund. Es handelt sich um Hochstaudensäume (3,5 %) und Gewässerbegleitgehölze (7,8 %) entlang der an einigen Stellen noch naturnah mäandrierenden Bäche. Nasswiesen in den Tälern nehmen 10,9 % aller Biotopflächen ein. Naturschutzfachlich bedeutende Felsspalten- und Felsgrusgesellschaften auf Dolomitriffen und Schuttkegeln mit Reliktstandorten endemischer Pflanzenarten sind auf kleine Flächen beschränkt. Die Hangbereiche sind durch reichstrukturierte, orchideen- und lilienreiche Laubhang- und Hangschuttwälder bestockt.
070 Oberpfälzisches Hügelland
Das Oberpfälzische Hügelland ragt als südöstliche
Verlängerung des Obermainischen Hügellandes mit dem Gebiet
um Speichersdorf in die Region 5 hinein. Die Grenze wird durch die flache
Wasserscheide der Flusssysteme von Main und Donau bestimmt. Die Landschaft
zeichnet sich durch ein lebhaftes, flachhügeliges Relief und den
Wechsel von etwas größeren Waldbereichen und intensiv landwirtschaftlich
genutzten Flächen aus, wobei das Grünland, das wesentlich
auf die Tallagen beschränkt ist, das Ackerland an Fläche übertrifft.
Hinsichtlich der Flächenausdehnung dominieren unter den amtlich
kartierten Biotopen feuchtegeprägte Lebensräume wie Hochstauden,
Nasswiesen, Röhrichte, Ge-wässerbegleitgehölze und sonstige
Feuchtwälder (zusammen ca. 73,7 % aller Biotopflächen) Mesophile
oder trockenere Biotope wie Hecken (7,9 %) oder extensive Wiesen
(5,9 %) treten dagegen seltener auf.
071 Obermainisches Hügelland
Das Obermainische Hügelland ähnelt mit einem ebenfalls lebhaften Relief und dem Nutzungsmosaik von größeren Waldbereichen und intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen landschaftlich dem Oberpfälzischen Hügelland. Die Waldstandorte (21,7 %) auf nährstoffarmen Böden oder steilhängigen Lagen zeichnen den SO-NW-Verlauf der härteren Gesteinschichten und damit der Höhenzüge nach. In den Auen der Flüsse (Weißer und Roter Main, Steinach) ist der ursprüngliche Auwald gerodet, auf den feuchten Schwemmlandstandorten dominiert noch die Grünlandnutzung. Ebenfalls grünlandgeprägt ist der Hummelgau westlich Bayreuth. Der Anteil der Ackerstandorte nimmt nach Norden hin zu.Nahezu waldfrei ist ein mindestens fünf km breiter Landstreifen am Fuß von Fichtelgebirge und Frankenwald in der Linie Stadtsteinach – Weidenberg, in dem auf Muschelkalkstandorten Ackerbau, auf Gipskeuper- und Rötstandorten Grünlandnutzung vorherrscht. Ausgedehnte Waldbereiche (Flächenanteil insgesamt 21 %) beschränken sich v.a. auf den Limmersdorfer Forst, größere Waldgebiete sind noch der Kulmbacher Forst und Ziegelhüttener Forst.Sowohl hinsichtlich der Flächenzahl als auch des Flächenanteils dominieren in diesem Naturraum unter den amtlich erfassten Biotopen die Gewässerbegleitgehölze (23,9 % der Biotopflächen), sowie Hecken und Feldgehölze (zusammen 27,8 %, z.B. „Bergfeld“ westlich Stadtsteinach). Zahlreiche Hochstaudenbestände (3,3 %) und Nasswiesen (5,3 %) in den Flusstälern tragen zum vergleichsweise hohen Anteil der feuchtegeprägten Biotope bei, wogegen die Trockenlebensräume mit insgesamt 13,3 % Anteil an gesamten Biotopflächen zurücktreten.
392 Nordwestlicher Frankenwald
Der Frankenwald, die südöstliche Verlängerung des Thüringer Waldes ragt im nördlichen Landkreis Kulmbach und im Westen des Landkreises Hof in die Region 5 hinein. Es handelt sich um einen flachwelligen Höhenzug mit Höhenlagen bis zu 700 m ü.NN, in den engschluchtige Kerbsohlentäler eingeschnitten sind. Dementsprechend überwiegt der Waldanteil (ca. 50,5 %) die landwirtschaftlichen Nutzflächen (42,3 %) deutlich. Die Wälder werden von Fichtenbeständen dominiert. Mit abnehmenden Niederschlägen nimmt der Waldanteil innerhalb des Naturraumes nach Norden und Osten ab.Im Frankenwald konzentrieren sich naturnahe Flächen mit geringem menschlichen Nutzungsdruck in den Talauen der Bäche. Feuchtlebensräume nehmen daher über 56 % der amtlich kartierten Biotope ein, wobei Gewässerbegleitgehölze (14,7 %) und Hochstaudenbestände (22,6 %) besonders hervortreten. Naturnahe Flächen mit mesophiler (insgesamt 17,8 %) oder trockener bzw. trockenwarmer Prägung (25,9 %) treten demgegenüber zurück. </p> <p>Das Charakteristikum des Frankenwaldes, das Extensivgrünland (z.B. Bärwurzwiesen), wird in den hohen Prozentanteilen der Biotoptypen „Magerrasen bodensauer“ (3,7 %), „Wiese, Weide extensiv“ (12,9 %) und „Altgrasbestand“ (7,8 %) deutlich.
393 Münchberger Hochfläche
Die Münchberger Gneismasse befindet sich zwischen Nordwestlichem Frankenwald und Hohem Fichtelgebirge. Es handelt sich um eine flachreliefierte Hochfläche auf ca. 600 m ü.NN mit einer deutlich dominierenden Landwirtschaft (70,4 %), wogegen die forstliche Nutzung mit 19,4 % Flächenanteil zurücktritt. Zusammen mit dem Mittelvogtländischen Kuppenland weist die Münchberger Gneismasse innerhalb der Region 5 die geringsten Waldanteile auf. Nur im südwestlichen Teil des Naturraumes, im Bereich der „Marktschorgaster Frankenwaldabdachung“ ist der Waldanteil höher. Acker- und Mischnutzung herrschen vor, das Grünland nimmt nur 8,9 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche ein. Mit abnehmender Niederschlagsmenge nimmt nach Osten hin die Bedeutung der Wiesennutzung ab.In den flachen Mulden des klimatisch als feucht-kühl zu bezeichnenden Hochplateaus befinden sich zahlreiche, heute stark verlandete Weiher und Teiche mit Vermoorungen. Hochstaudenbestände (14,6 %), Nasswiesen (10,4 %) sowie Flachmoore und Streuwiesen (8,8 %) nehmen entsprechend neben Gewässerbegleitgehölzen (20,1 %) den größten Flächenanteil an den erfassten Biotopen ein.In der vergleichsweise waldarmen Hochfläche kommt unter den mesophilen Lebensraumtypen den Hecken und Feldgehölzen mit zusammen 17,5 % Biotopflächenanteil die größte Bedeutung zu. Trockenlebensräume treten vergleichsweise selten und kleinflächig auf, wobei die Serpentin-Felsspaltengesellschaft (z.B. Woja-Leite) als eine streng gesteinsgebundene, kleinflächige Besonderheit zu nennen ist.
394 Hohes Fichtelgebirge
Das Hohe Fichtelgebirge mit seinen höchsten Erhebungen Schneeberg und Ochsenkopf umschließt als nach Osten offener, hufeisenförmiger Gebirgswall aus Granit die Selb-Wunsiedler Hochfläche. Er ist auf Grund der Höhenlage von 600 m bis 1.000 m ü.NN durch raues, niederschlagsreiches (Regenstau), montan geprägtes Klima und durch ungünstige Bodeneigenschaften gekennzeichnet. Entsprechend gering ist der Anteil an landwirtschaftlichen, insbesondere ackerbaulich genutzten Flächen. Wald dominiert mit einem Flächenanteil von 80,8 % deutlich, wobei Fichtenforste vorherrschen. Nutzflächen (überwiegend Grünland, 6,9 %) sind mit einer Obergrenze von ca. 700 m auf die Rodungsinseln beschränkt.
Naturschutzfachlich bedeutsam sind die Hoch- und Zwischenmoore, die Bergwiesen und bodensauren Magerrasen (8,4 %). Die Hoch- und Zwischenmoorstandorte (9,3 %) sind trotz teilweiser Degeneration im Zuge von Torfabbau und Entwässerung noch in hohem Maße schutzwürdig (z.B. Fichtelseemoor, Wolfslohe, Torfmoorhölle, Königsheide). Nasswiesen (12,4 %) sowie Flachmoore und Streuwiesen (9,7 %) sind vom Flächenanteil her ebenfalls bedeutsam.
Die in den Gipfellagen vorhandenen Fels- und Blockmeere (z.B. Kornberg, Haberstein, Nußhardt, Platte, Schneeberg, Ochsenkopf, Kösseine, u. a.) beherbergen eine charakteristische Moos- und Flechtenvegetation. Dieser Biotoptyp nimmt 31,7 ha (entsprechend 2,8 % der Biotopfläche) ein.
395 Selb-Wunsiedler Hochfläche
Die Selb-Wunsiedler Hochfläche, das Innere Fichtelgebirge (ca. 600 m ü.NN), ist großflächig einheitlich durch ein Mosaik verschiedener Nutzungstypen geprägt. Waldbedeckte Hügelkuppen, ackerbaulich genutzte Gebiete und weite, grünlandgenutzte Talsenken wechseln sich ab. Gegenüber dem Hohen Fichtelgebirge nimmt die landwirtschaftliche Nutzung mit 61,7 % einen deutlich größeren Stellenwert ein, wobei in steileren Lagen historische Ackerterrassen typisch für die Kulturlandschaft sind. Besonders stark gerodet sind die Talmulden an den Oberläufen von Eger und Röslau.
Die nach Osten hin offene, nach Westen aber durch das Hohe Fichtelgebirge umgrenzte Selb-Wunsiedler Hochebene weist auf Grund dieser Lage einen höheren Anteil kontinentaler Pflanzenarten auf. Naturnahe Vegetationstypen sind Weiher mit Verlandungsvegetation, Hoch- und Zwischenmoore (z.B. Häusellohe, Zeitelmoos), Flachmoore und Streuwiesen, Nass- und Feuchtwiesen sowie Hochstaudenfluren. Die Auen der beiden wichtigsten, nach Osten entwässernden Flüsse Eger und Röslau weisen noch bedeutsame Feuchtlebensräume wie Erlenwälder auf. Feuchtgeprägte Biotoptypen nehmen dementsprechend mit 73,9 % einen großen Teil der Biotopflächen ein.
Der Selber Forst schließt die Selb-Wunsiedler Hochfläche nach Nordosten hin ab. Das geschlossene Waldgebiet nimmt auf Grund des Vorkommens der „Selber Höhenkiefer“ sowie der Schneeheide-Weißmoos-Kiefernwälder und der Waldmeister-Buchenwälder am Hengstberg eine Sonderstellung ein.
411 Mittelvogtländisches Kuppenland
Im Mittelvogtländischen Kuppenland, das sich in nordöstlicher Richtung an Frankenwald und Münchberger Gneismasse anschließt, setzt sich der nach Nordosten zunehmend waldärmere Landschaftscharakter dieser beiden Naturräume fort. Die Landschaft nördlich von Hof ist geprägt durch intensiven Ackerbau (54,4 %), hinter den andere landwirtschaftliche Nutzungsformen zurücktreten. Wald nimmt nur noch 13,5 % der Fläche dieses Naturraumes in der Region 5 ein.
Naturbetonte Flächen sind in diesem Raum der Region deutlich unterrepräsentiert. Unter den naturnahen Flächen nehmen Feuchtlebensräume wie Hochstaudenbestände (4,6 % der Biotopfläche), Nasswiesen, Flachmoore und Streuwiesen (zusammen 11,3 %) mit zusammen insgesamt 37 % aller amtlich kartierten Biotope ungefähr den gleichen Anteil ein wie mesophile Lebensräume. Hecken (9,7 %) und Feldgehölzen (5 %) kommt in den Ackerfluren als gliedernde Elemente und Rückzugsgebiete für die Fauna eine große Bedeutung zu. Grünlandgeprägt ist z.B. die Aue der Südlichen Regnitz.
Landschaftsbereichernde Strukturen wie Hecken, Gebüsche und Feldgehölze sind laut ABSP (StMLU 1994) häufig auf Bereiche in unmittelbarer Nähe zur ehemaligen DDR-Grenze konzentriert.
412 Oberes Vogtland
Das Obere Vogtland schließt südöstlich an das Mittelvogtländische Kuppenland an. Dieser Naturraum greift nur mit dem Rehauer Forst östlich Rehau in die Region 5 hinein. Der Nadelwald dominiert mit nahezu 80 % das Landschaftsbild. In den Offenlandbereichen herrscht Acker- und Mischnutzung vor.
Über 96 % aller kartierten
Biotope in diesem Naturraum sind Feuchtlebensräume. Niedermoor- und
Streuwiesenvegetation nimmt alleine 57,7 % der gesamten Biotopfläche
ein.
Als Lebensraumkomplexe werden Gebiete zusammengefasst, in denen eine Vielzahl unterschiedlicher naturbetonter Biotope nebeneinander und in enger Verzahnung miteinander vorkommen. Sie stellen vor allem faunistisch bedeutsame Lebensräume dar und sind Schwerpunktgebiete des Naturschutzes. Lebensraumkomplexe sind v. a. für Tierarten mit großen Aktionsradien, hoher Störanfälligkeit und vielfältigen Ansprüchen an ihren Lebensraum von hoher Bedeutung.
Die Arten- und Biotopschutzprogramme der Landkreise Bayreuth (StMLU 2002), Kulmbach (StMLU 1997), Hof (StMLU 1994), Wunsiedel (StMLU 1999) und Tirschenreuth (StMLU 1991) nennen folgende wichtige Lebensraumkomplexe:
-
Die Lebensraumkomplexe der Täler in der Frankenalb mit Magerrasen, Wacholderheiden, Felsen, naturnahen Hangwäldern und Feuchtstandorten entlang der Bäche.
-
Die Heckenlandschaften und Trockenlebensraumkomplexe der Albhochflächen. Sie sind durch Feldgehölze, trockene Säume, Magerrasen und Felskuppen, sowie durch Höhlen, Dolinen und vereinzelte Feuchtflächen gekennzeichnet.
-
Die Talräume vieler Gewässer, wie z.B. von Steinach, Schorgast, Eger, Röslau, Sächsischer Saale, Weißem Main, Püttlach oder Pegnitz weisen Aue-Lebensraumkomplexe aus verschiedenen Feuchtstandorten wie Gewässerbegleitgehölze, Bruchwälder, Großseggenriede, Feucht- und Nasswiesen sowie strukturreiche und mäandrierende Flussabschnitte auf.
-
Den Fließgewässern kommt auf Grund ihrer linearen Erstreckung und trotz z. T. unterbrochener biologischer Durchgängigkeit eine hohe Vernetzungsfunktion für die aquatische Fauna zu.
-
Im Bereich der Münchberger Hochfläche, des Fichtelgebirges und der Selb-Wunsiedler Hochfläche treten kleinräumig Nieder- und Hochmoorkomplexe auf, in denen die Standortbedingungen auf engstem Raum wechseln.
-
Durch ein enges räumliches Nebeneinander unterschiedlicher Waldgesellschaften und Waldbiotoptypen können sich auch in Wäldern spezifische Lebensraumkomplexe ausbilden.
Lebensräume
Wälder
Der Waldanteil der Region liegt mit 39,6 % deutlich über dem bayerischen (ca. 34,6 %) oder gar bundesdeutschen Durchschnitt (29 %) (Oberforstdirektion Bayreuth 1992). In der Nördlichen Frankenalb, dem Obermainischen Hügelland, der Münchberger Hochfläche und der Selb-Wunsiedler Hochfläche überwiegen die relativ kleinflächigen, inselartig in der umgebenden Kulturlandschaft eingestreuten Waldbestände. Ausgedehnte Waldflächen gibt es im Veldensteiner Forst südlich von Pegnitz, dem Selber Forst, dem Limmersdorfer Forst, dem Frankenwald sowie v. a. dem nahezu vollständig von Wald bedecktem Hohen Fichtelgebirge mit Steinwald, Reichswald und Arzberger Forst und im Oberen Vogtland (Rehauer Forst).
Das Maintal ist überwiegend waldfrei. Sehr waldarm sind auch der Hummelgau westlich von Bayreuth sowie das Mittelvogtländische Kuppenland um Hof.
Die Waldbestände der Region sind entsprechend der geologischen Vielgestaltigkeit und der unterschiedlichen Höhenlage trotz häufig vereinheitlichender forstlicher Nutzung unterschiedlich ausgeprägt. Höhere Laub- und Mischwaldanteile treten z.B. in der Nördlichen Frankenalb (z.B. um Betzenstein, Pottenstein, westlich von Pegnitz, im Aufseßtal, sowie östlich von Hollfeld und Waischenfeld), östlich von Bayreuth, um Kulmbach, nordöstlich der Fränkischen Linie, im Marktredwitzer Stadtwald, im Geroldsgrüner Forst des Frankenwaldes und nördlich von Hohenberg auf. Ausgedehnte Nadelwaldbestände dominieren u. a. den Veldensteiner Forst, den Selber Forst (jeweils Kiefer), große Teile des Frankenwaldes, das Hohe Fichtelgebirge und den Rehauer Forst (jeweils Fichte).
Feuchtlebensräume unterschiedlicher Typen (Quellbereiche, Bachläufe, Feuchtwälder, Moorbildungen) weisen in den Wäldern des Frankenwaldes und des Fichtelgebirges (z.B. Zeitelmoos, Torfmoorhölle, Häusellohe) häufig noch einen guten Erhaltungs- und Vernetzungszustand auf, der bei vergleichbarer Lage außerhalb der Wälder durch angrenzende Nutzungen meist stark gestört ist.
Eine Reihe besonderer Standortkombinationen führen in Oberfranken zu Waldgesellschaften mit seltenen und schützenswerten Pflanzen und Tieren, die von herausragender Bedeutung sind. Beispielhaft seien hier genannt: Die Steil- und Schluchtwälder (z.B. Laubhangwälder bei Pottenstein oder Höllental nördl. Naila), Steppenanemonenkiefernwälder (auf Dolomitasche in der Frankenalb), Serpentin-Kiefernwälder (entlang des Serpentinzuges der Münchberger Hochfläche mit Verlängerung bis zum Peterleinstein bei Kupferberg am Fuße des Frankenwaldes), die Schneeheide-Weißmoos-Kiefernwälder (der Selb-Wunsiedler Hochfläche, z.B. im Selber Forst oder Arzberger Forst), die Moorspirkenbestände (z.B. in der Torfmoorhölle bei Weißenstadt), die Buchenwälder mit Frauenschuhbeständen der Betzensteiner Kuppenalb oder Flachbärlappvorkommen (z.B. im Lindenhardter Forst).
Hecken, Gebüsche und Feldgehölze
Hecken, Gebüsche und Feldgehölze gehören zu den in der gesamten Region vorkommenden Lebensräumen. Die Dichte der Hecken als landschaftsprägende Elemente sind jedoch sehr unterschiedlich. So gibt es in der Region 5 Bereiche, die besonders geringe Bestände von Hecken, Gebüschen und Feldgehölzen aufweisen. Hierzu gehören die ackerbaulich intensiv genutzten Lagen der Münchberger Hochfläche oder des Mittelvogtländischen Kuppenlandes sowie die fast ausschließlich bewaldeten Naturräume Hohes Fichtelgebirge und Oberes Vogtland.
Die Schwerpunkte der Heckenverbreitung liegen in den Anstiegsbereichen der Deckgebirgsformationen (StMLU 1994), besonders heckenreich sind Muschelkalkstandorte (StMLU 1997). Gebiete mit hoher Heckendichte sind z.B. das „Bergfeld“ bei Stadtsteinach, der Strengleinsberg bei Kauerndorf, im Südosten des Muschelkalkzuges bei Lanzendorf, auf der Malm-Hochfläche der Kirchleuser Platte, die Ködnitzer Weinleite, die Albhochfläche bei Wonsees und Obernsees, sowie regional und überregional bedeutsame Hecken-Ranken-Komplexe auf der Selb-Wunsiedler Hochfläche (z.B. zwischen Schönbrunn und Wunsiedel).
Quellen
Wo die Grundwasserhorizonte in den Tälern ausstreichen und besonders an den Kreuzungen von Verwerfungen (z.B. Fränkische Linie, Kulmbacher Störungszone) mit Tälern kommt es häufig zur Bildung von Schichtquellen und Quellhorizonten. Fließquellen sind selten und meist durch menschliche Einflüsse (Quellfassung, Eintiefung) entstanden.
Quellaustritte befinden sich häufig in kleinflächigen Feuchtwäldern und Feldgehölzen sowie im Grünland mit Feuchtwiesen und Niedermooren. Eine hohe Dichte lt. ABSP überregional bis landesweit bedeutsamer Quellen ist im Fichtelgebirge, im Frankenwald und im Limmersdorfer Forst anzutreffen. Arm an Quellen ist z.B. das niederschlagsärmere Mittelvogtländische Kuppenland.
Eine Besonderheit in der Region sind die Mineralquellen (so genannte Kohlensäuerlinge), z.B. die „Hubertusquelle“ im Höllental, die Heilquelle bei Bad Alexandersbad oder die „Karolinenquelle“ im Egertal bei Hohenberg.
Flüsse
Der Main mit seinen beiden Quellflüssen Roter und Weißer Main sowie die Sächsische Saale sind die größten Flüsse der Region. Die Unterläufe von Eger und Röslau sind als Kleinflüsse zu bezeichnen.
Die Talauen werden abschnittsweise intensiv landwirtschaftlich genutzt, wobei die Nutzung häufig bis an die Gewässer heranreicht. Ausgedehnte naturnahe Retentionsräume existieren im Obermaintal. Auch die Flüsse Roter Main, Weißer Main und Saale zeichnen sich in der Region Oberfranken-Ost streckenweise noch durch einen naturnahen Verlauf aus. Dagegen ist die Eger durch Stauwerke und Ausleitungsstrecken in ihrer Flussdynamik auf weiten Strecken verändert.
Trotz der vorhandenen Beeinträchtigungen kommt den Flüssen als Grundgerüst eines aquatischen Verbundsystems große Bedeutung zu. Die Eger stellt eine überregional wirksame Ausbreitungsachse zwischen dem Egerer Tertiärbecken und dem nordbayerischen Raum dar (StMLU 1999).
Bäche
Bäche bilden in vielen Fällen die einzigen durchgehenden linearen Strukturen der Region und stellen damit wichtige Verbundachsen dar. Längere naturnahe Bachabschnitte gibt es unter anderem noch an Selbitz, Wilder Rodach, Ölschnitz, Steinach, Trebgast, Markgrafenbruchbach, Thüringische Muschwitz, Südlicher Regnitz, Zinnbach, Zeitelmoosbach, Perlenbach und Steinselb. Die in einigen Bächen noch vorkommenden Muschelbestände (z.B. in der Südlichen Regnitz oder im Ailsbach) sind von besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung.
Gräben
Heute noch offene, und nicht im Rahmen der landwirtschaftlichen Intensivierung verrohrte Gräben befinden sich i.d.R. am Rande von oder in extensiv genutzten Feucht- oder Streuwiesen oder Feuchtwäldern (z.B. Grünlandgebiete bei Bad Steben, Maintalaue, Moorgraben im Zeitelmoos).
Wegen der zunehmenden Degradierung und Zerstörung von primären Feuchtlebensräumen gewinnen Gräben zunehmend auch Bedeutung als Auffang- und Kompensationslebensräume, wobei sie diese Funktion nur dann übernehmen können, wenn notwendige Räumungsarbeiten darauf Rücksicht nehmen und schonend durchgeführt werden (vgl. Art. 6 BayNatSchG).
Stillgewässer
Altwasser in den Flussauen (Main, Sächsische Saale, Südliche Regnitz, Röslau) sind die einzigen größeren, natürlich entstandenen Stillgewässer der Region.
Künstliche Stillgewässer sind die durch Aufstauung entstandene Förmitztalsperre, der Weißenstädter See, der Untreusee und der Fichtelsee sowie die durch den Sand- und Kiesabbau im Obermaintal entstandenen Baggerseen. Baggerseen können sich zu wertvollen Sekundärlebensräumen entwickeln. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sowohl gelingt, den Nutzungsdruck durch Erholungssuchende als auch den Nährstoffeintrag zu minimieren. Die im Sommer stark frequentierte Förmitztalsperre stellt in der restlichen Zeit des Jahres einen bedeutenden Rastplatz für Zugvögel dar.
Teiche sind ebenfalls anthropogen geschaffene Stillgewässer und finden sich gehäuft in der Region z.B. auf der Münchberger Hochfläche, der Selb-Wunsiedler Hochfläche oder im Obermainischen Hügelland, v.a. entlang des Roten Maines (z.B. der Craimoosweiher mit landesweiter Bedeutung für den Arten und Lebensraumschutz) und im Oberpfälzischen Hügelland entlang der Haidenaab. Als Lebensräume einer reichen Amphibien- und Libellenfauna kommt besonders extensiv genutzten Teichen mit größerer Schwimmblatt- oder Unterwasservegetation große Bedeutung zu. Die Region weist in den Moorgebieten oder den Talauen der größeren Fließgewässer (z.B. des Roten Mains) auch einige Stillgewässer natürlichen Ursprungs auf.
Tümpel und ephemere Kleingewässer treten in der Region vor allem in Abbaustellen auf (z.B. Sandgruben im Maintal, Steinbrüche im Fichtelgebirge). Als Lebensraum für Pionierarten (z.B. Kreuzkröte, Knoblauchkröte) kommt ihnen trotz ihrer geringen Ausdehnung hohe Bedeutung zu. Eine besondere Bedeutung kommt den Hüllweihern zu, die in tonigen Mulden der sonst wasserarmen Hochfläche der Frankenalb nur vom Regen gespeist entstehen (daher auch „Himmelsweiher“ genannt). Sie sind dort oft die einzigen dauerhaften Gewässer und daher unverzichtbare Trittsteine für den Verbund aquatischer Lebensräume.
Feuchtgebiete
Intakte und bewirtschaftete Feucht- und Nasswiesen gehören auch in der Region Oberfranken-Ost zu den seltenen Lebensräumen. Einen vergleichsweise größeren Anteil an der Gesamtfläche nehmen Feuchtlebensräume im Frankenwald, im Oberen Vogtland und der Selb-Wunsiedler Hochfläche ein. Talbereiche mit Nass-, Feucht- und Streuwiesen, wie sie in den Talsystemen der Region z. T. noch vorzufinden sind, haben daher überregionale bis landesweite Bedeutung. Eine besonders hohe Dichte hochwertiger Feuchtwiesenareale weist das Fichtelgebirge auf (z.B. Egeraue, Perlbachtal, Sandlohbach).
Hochstaudenfluren, Großseggenriede und Röhrichte kommen in z. T. enger Verzahnung an den Altwässern und in den Auen des Maines, nordwestlich Lehesten, in der Regnitzaue westlich Weinzlitz, im Föhrigbachtal nordöstlich Selbitz, im Eger- und Perlenbachtal vor.
Niedermoore, Kleinseggenriede und Streuwiesen wurden durch Entwässerung und Nutzungsintensivierung in der Vergangenheit stark dezimiert. Schwerpunkte des Vorkommens in der Region liegen in den feucht-kühlen Naturräumen Frankenwald, Münchberger Hochfläche, Fichtelgebirge, Selb-Wunsiedler Hochfläche und Oberes Vogtland (Rehauer Forst). Zu nennen wären z.B. die Vorkommen nordöstlich von Hohenberg im Landkreis Kulmbach, am Kleinen und Großen Koserbach, in der Bachaue östlich Naila, die Moorflächen bei Ziegelhütte, das Quellflachmoor südwestlich Wölbersbach, das Niedermoor nordöstlich Waldhaus, das NSG Zeitelmoos, sowie Vorkommen im Tal der Eger, des Perlenbaches und des Sandlohbaches.
Zwischen- und Hochmoore treten auf Grund der klimatischen Voraussetzungen (feuchtes, kühles Mittelgebirgsklima, Jahresniederschläge bis 1.250 mm, Jahresmitteltemperatur 6 bis 7°C) gehäuft im Fichtelgebirge und auf der Selb-Wunsiedler Hochfläche auf (z.B. Fichtelseemoor, Zeitelmoos, Torfmoorhölle-Voitsumra, Wulgera, Häusellohe, Hahnenfilz). Außerhalb dieser Naturräume sind ehemalige kleinflächige Hochmoorflächen durch Entwässerung oder Torfabbau bis auf Restflächen, wie z.B. das Lindauer Moor im Obermainischen Hügelland weitgehend zerstört. Als Glazialreliktbiotope für konkurrenzempfindliche Pflanzenarten mit nordischer Verbreitung kommt diesen Standorten überregionale bis landesweite Bedeutung zu. Kaule (1974, zit. in StMLU 1999) stuft das Fichtelseemoor sogar als Moorstandort von nationaler Bedeutung ein.
Trockenstandorte
Trockene und magere Grasfluren kommen in der Region schwerpunktmäßig in der Nördlichen Frankenalb (Kalkmagerasen auf Jura), im Obermainischen Hügelland (auf Muschelkalk) und im Fichtelgebirge (Bodensaure Magerrasen) vor. Die Magerrasen beinhalten häufig noch andere Biotoptypen: es handelt sich um strukturreiche Biotopkomplexe mit Extensivwiesen, Hecken und Gebüschen, oft auch Streuobstbeständen, Waldrändern und wärmeliebenden Säumen.
Die Magerrasen auf Kalk sind i. d. R. durch Beweidung entstanden. Auf Grund der großen Anzahl von Teilflächen soll hier nur eine Auswahl genannt werden: Mager- und Trockenstandorte östlich und südlich von Wonsees, Ködnitzer Weinleite, Wacholderhänge Pottenstein, Halbtrockenrasenkomplexe um Schirradorf, Görauer Anger. Auf der Selb-Wunsiedler Hochebene zählen Kalkmagerrasen aus geologischen Gründen zu den seltenen Biotoptypen. Überregional bedeutsam sind z.B. die Standorte in den Marmorsteinbrüchen bei Sinatengrün, Stemmas und Ziegelhütte.
Die bodensauren Magerrasen (Borstgrasrasen) sind wohl zumeist durch Mahd entstanden. Im Frankenwald, dem Fichtelgebirge und auf der Münchberger Hochfläche sind nur mehr kleine und kleinste Restflächen vorhanden, z.B. in den Rodungsinseln Nagel und Mehlmeisel, im Steinbruch bei Ziegelhütte, am Galgenberg bei Bernstein, östlich Kautendorf. Auf der Selb-Wunsiedler Hochebene nehmen dagegen trockene bis stau- und wechselfeuchte Borstgrasrasen größere Flächen ein.
Im nördlichen Teil der Region, in den Landkreisen Kulmbach (nördlicher Teil) und Hof bildeten sich auf devonischen Diabasen mehr oder weniger basenreiche Magerasen. Vor allem die kleinräumigen Standorte auf Serpentin bilden durch ihre Vegetationszusammensetzung aus spezialisierten Pflanzenarten eine Besonderheit in der Region und darüber hinaus (z.B. Peterleinstein, Wojaleite bei Wurlitz). Charakteristische Trockenlebensräume wie Felsspalten-, Felsgrus- oder Felsbandfluren haben sich auf verschiedenen Felsbildungen der Region eingestellt, wie z.B. auf den Dolomit- und Riffkalkfelsen der Frankenalb, den Granit- oder Basaltfelsen der Selb-Wunsiedler Hochfläche, den Diabasfelsen in Frankenwald (z.B. Höllental) und dem Bayerischen Vogtland oder auf den Serpentinfelsen der Münchberger Hochfläche (z.B. Wojaleite).
Die Gipfellagen des Fichtelgebirges werden durch Blockschutt- und Felsenmeere geprägt, die durch die für Granite typische Wollsackverwitterung entstanden sind (z.B. Epprechtstein, Schneeberg, Rudolfstein, Luisenburg, Große und Kleine Kösseine, Kleines Labyrinth u. v. m.).
In einigen Teilräumen gibt es Felsbildungen mit eigenen, charakteristischen Felsvegetationen.
Abbaugebiete
In den z. T. großflächigen Abbaustellen des Maintales wird Sand- und Kies abgebaut. In den anderen Naturräumen existieren Steinbrüche der anstehenden Gesteine (z.B. Malmkalk, Rhätsandstein, Granit, Diabas, Schiefer, Serpentin, Gneis, Marmor, Syenit). Als Sekundärlebensraum für zahlreiche Pionierarten unter der Vogel-, der Amphibien- und Wirbellosenfauna kommt diesen Standorten z.T. große Bedeutung zu. Beispiele in der Region 5 sind die Sandgrube am Heidelberg, der Steinbruch westlich Kirchleus, die ehemalige Sandgrube östlich von Oberkeil, der Schieferbruch bei Eisenbühl und der Diabassteinbruch östlich Selbitz.
Fauna
080 Nördliche Frankenalb
Die reichhaltige Ausstattung der Nördlichen Frankenalb mit artenreichen und hochspezialisierten Pflanzengesellschaften bietet die Grundlage für eine große Vielfalt auch in der Tierwelt.
Als charakteristische und bedrohte Vertreter der Vogelwelt sind beispielsweise Neuntöter und Dorngrasmücke zu nennen, die als Heckenbewohner die zahlreichen Gebüsche und wärmegetönten Säume besiedeln. Natürliche und künstliche (Steinbrüche) Felswände bieten Wanderfalke und Uhu Nistmöglichkeiten.
Die naturnahen und meist unverbauten Fließgewässer mit ihren maximal mäßig und streckenweise (Püttlach östlich von Pottenstein) gering belasteten Abschnitten weisen u.a. Vorkommen von Wasseramsel, Eisvogel, Bachneunauge, Elritze, Äsche, Steinkrebs, Edelkrebs und Bachmuschel auf. Sie stellen landesweit bzw. abschnittsweise zumindest überregional bedeutsame Lebensräume dar. Aus der Tiergruppe der Säugetiere sind die Fledermäuse zu nennen, die in den zahlreichen Naturhöhlen und Felsspalten, aber auch Felsenkellern geeignete Winterverstecke finden. Der Naturraum beherbergt im Landkreis Bayreuth drei überdurchschnittlich große Wochenstubenkolonien des Großen Mausohrs. Zwei weitere befinden sich unmittelbar benachbart am Westrand des Obermainischen Hügellandes. In alten ungenutzten Kellern westlich Bayreuth gelangen in den vergangenen Jahren die letzten nordbayerischen Nachweise der einstmals weit verbreiteten Kleinen Hufeisennase.
Die (Halb-)Trockenrasen werden von zahlreichen und z. T. hochgefährdeten Arten aus den Gruppen der Wildbienen, Tagfalter und Heuschrecken besiedelt.
070 Oberpfälzisches Hügelland
Im Oberpfälzischen Hügelland sind faunistisch
bedeutsamere Lebensräume v. a. die Feuchtlebensraumkomplexe im Haidenaabtal
und Gabellohe, die z.B. Bibervor-kommen, einzelne Wiesenbrüter (Bekassine)
oder Laub- und Moorfrosch aufweisen sowie die extensiven Grünlandbereiche
der "Schernwiesen" am Südostrand. In den größeren
Kiefernwäldern am Westrand des Naturraumes kommen einige gefährdete
und anspruchsvollere Waldarten, wie der Sperlingskauz, der Rauhfußkauz,
oder die Waldschnepfe vor.
071 Obermainisches Hügelland
Im Naturraum Obermainisches Hügelland kommt
der Flussaue des Roten Mains als Nahrungs- und Brutlebensraum für
Weißstorch (Horste z.B. in Altdrossenfeld, Mel-kendorf), Wachtelkönig,
Braunkehlchen, Bekassine, Wiesenpieper und Rohrweihe große Bedeutung
zu (ABSP KU, STMLU 1997). Der "Limmersdorfer Forst" beher-bergt
Schwarzstorch, Rauhfußkauz, Sperlingskauz, Uhu, Hohltaube und Ziegenmel-ker.
Die Heckengebiete des Muschelkalkzuges, wie Bergfeld oder Lanzendorf sind wertvolle Lebenrsräume gefährdeter Vogelarten wie dem Raubwürger, Neuntöter oder der Dorngrasmücke.
Unter den Fledermäusen sind besonders die Vorkommen der vom Aussterben bedrohten Mopsfledermaus zu nennen. In der Kulmbacher Plassenburg befindet sich gem. der von Rudolph (2000) veröffentlichten Kriterien ein bundesweit bedeutsames Mopsfledermaus-Winterquartier. Die Wochenstuben in Trebgast, Katschenreuth und Mainleus zeigen eine nennenswerte Häufung von Fortpflanzungsquartieren der Mopsfledermaus, von denen in Bayern nur wenige bekannt sind.
Naturschutzfachlich besonders bedeutsam sind Vorkommen des in Bayern vom Aussterben bedrohten Storchschnabel-Bläulings (Eumedonia eumedon) im Obermaintal. Es handelt sich z.B. um Flächen im NSG „Mainaltwasser bei Mainleus“, extensive Wiesen im Tal des Roten Mains und den LB „Feuchtbereich südlich von Oberzettlitz“. Unter den Insekten ist ferner das isolierte Vorkommen der stark gefährdeten Kurzflügligen Schwertschrecke im Tal des Roten Main zu nennen. Vor allem in den Auen des Obermaintals, und des Roten Mains gibt es auch Schwerpunktvorkommen der streng an Nasswiesen gebundenen und in Bayern gefährdeten Sumpfschrecke. In geringeren Dichten findet sie sich auch entlang der Trebgast, Schorgast und Steinach. Einzelne Bäche (Lainbach) sind bedeutsame Lebensräume der gefährdeten Bachmuschel.
Naturschutzfachlich hochwertige Gewässer wie der Craimoosweiher sind Lebensräume des in Bayern vom Aussterben bedrohten Moorfrosches oder der gefährdeten Libellenart Granatauge.
392 Frankenwald
Der Schwarzstorch besiedelte in den letzen Jahren in zunehmendem Maß die ausgedehnten Wälder des Frankenwaldes. Er wurde lt. Artenschutzkartierung des LfU v. a. in dem nördlich an die Region angrenzenden Langenbacher Forst (Oberfranken-West) und entlang der Thüringer Muschwitz, aber vereinzelt auch im Geroldsgrüner Forst (Hänge des Lamitztales) nachgewiesen. Im Höllental, am Langenbachtal und entlang der Fränkischen Linie sind auch Vorkommen des Uhu bekannt.
Ein laut ABSP (StMLU 1994) überregional bedeutsames Wiesenbrütergebiet mit Vorkommen der Bekassine, des Braunkehlchens und des Wiesenpiepers befindet sich im Bereich der Bad Stebener Rodungsinsel.
In den landwirtschaftlich intensiv genutzten Ackerflächen nordöstlich von Selbitz kommt der stark gefährdete Feldhamster vor. Dieses Vorkommen setzt sich in das Mittelvogtländische Kuppenland nordwestlich Hof fort (StMLU 1994).
Aus den 90er Jahren liegen Nachweise des Fischotters von Bächen im Grenzgebiet zu Thüringen vor. Die Fledermausfauna des Frankenwaldes beherbergt u.a. mit Mops- und Nordfledermaus zwei Arten die typisch für montane Regionen sind. Bislang sind aus dem Frankenwald allerdings nur Winterquartierfunde (z.B. Schieferstollen Lotharheil) bekannt.
An der Landesgrenze zu Thüringen nordwestlich Lichtenberg befindet sich der einzige Nachweis der Gestreiften Quelljungfer (Cordulegaster bidentatus) im Landkreis Hof. Mehrere Bäche weisen noch gute Bestände von Koppe und Bachneunauge auf.
Offene Felslebensräume (wie z.B. im Höllental) stellen Lebensräume für die Schlingnatter, aber auch für seltene Schmetterlinge und Spinnen dar.
393 Münchberger Hochfläche
Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung der Münchberger Hochfläche und die damit verbundene Vereinheitlichung (z.B. geringer Anteil an Hecken, StMLU 1994) ist auch die Fauna des Gebietes vergleichsweise arm. Als charakteristische Art der Agrarlebensräume kommt der Feldhamster vor, von dem aus den 90er Jahren einzelne Beobachtungen vorliegen. In den Feuchtgebieten nördlich der Lamitzmühle sowie im Saaletal zwischen Förbau und Selbitz konnten sich Wiesenbrütervorkommen mit Bekassine, Braunkehlchen und Wiesenpieper halten. Die beiden letztgenannten Arten haben im Landkreis Hof einen bayerischen Verbreitungsschwerpunkt.
Die Förmitztalsperre hat sich zu den Zugzeiten zu einem bedeutenden Lebensraum mit Beobachtungen zahlreicher Enten-, Säger- und Taucherarten entwickelt.
Die Saale oberhalb Hof ist noch durch eine charakteristische und andernorts z. T. selten gewordene Fischfauna (z.B. Bachneunauge, Koppe, Elritze, Edelkrebs) ausgezeichnet.
394 Hohes Fichtelgebirge und 395 Selb-Wunsiedler Hochfläche
Das Hohe Fichtelgebirge beherbergt auf Grund der ausgedehnten Waldflächen und vergleichsweise geringen verkehrlichen Erschließung Vorkommen mehrerer bestandsgefährdeter Tierarten mit großem Raumbedarf.
So hat in lichten Waldteilen des Hohen Fichtelgebirges die größte ungestützte Auerhuhnpopulation außerhalb der Alpen überlebt (StMLU 1999). Der dortige Bestand in den Hochlagen wird auf ca. 60 Exemplare geschätzt. Gründe für den Rückgang sind hauptsächlich die veränderte Waldbewirtschaftung und der Verlust störungsarmer Rückzugsräume. Teilareale des Restvorkommens im Fichtelgebirge wurden Ende der 80er Jahre als Wildschutzgebiet mit zeitweisem Betretungsverbot ausgewiesen.
Im Fichtelgebirge existieren gegenwärtig sieben besetzte Weißstorchhorste. Diese Vorkommen sind Teil des Verbreitungsschwerpunktes im Naab- und Eger-Einzugsgebiet. Ein Brutpaar aus Waldershof nutzt die Meußelsdorfer Senke bei Marktredwitz als Nahrungshabitat. Der Schwarzstorch hat im Zuge seiner erneuten Arealausbreitung das Fichtelgebirge mit gegenwärtig mindestens fünf Brutpaaren besiedelt (StMLU 1999).
Die Vorkommen von Wachtelkönig, Bekassine und Rebhuhn sind stark zurückgegangen bzw. stehen kurz vor dem Verschwinden. Demgegenüber konnten sich in den letzten Jahrzehnten außer dem Schwarzstorch noch Kolkrabe, Uhu, Wanderfalke, Dreizehenspecht, Ringdrossel und Karmingimpel neu- bzw. wiederansiedeln (StMLU 1999), für den Raubwürger liegen Nachweise für fünf Brutpaare vor (Moder et al. 2001).
Für die Kreuzotter stellt das Fichtelgebirge ein bundesweit bedeutsames Verbreitungszentrum dar.
Unter den Säugetieren mit großen Arealansprüchen sind der Fischotter (Eger und Röslau), der Luchs, der Biber (Eger), sowie unter den Fledermäusen z.B. die Mops- und die Nordfledermaus zu nennen. Die beiden Fledermausarten haben, entsprechend ihrer Bevorzugung montan geprägter Lebensräume in den Ost- und Nordostbayerischen Grenzgebirgen einen Verbreitungsschwerpunkt im Fichtelgebirge mit jeweils mehreren Fortpflanzungsquartieren.
Die Moorgebiete im Fichtelgebirge sind Lebensraum landesweit bedeutsamer Bestände des Hochmoor-Bläulings (Vacciniia optilete) und insbesondere mehrerer vom Aussterben bedrohter Libellenarten, z.B. arktische Smaragdlibelle (Somatochlora arctica), Hochmoor-Mosaikjungfer (Aeshna subarctica), Mond-Azurjungfer (Coenagrion lunulatum), Alpen-Smaragdlibelle (Somatochlora alpestris), große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis), Nordische Moosjungfer (Leucorrhinia rubicunda).
Die Wirbellosenfauna des Fichtelgebirges wird des weiteren durch die Sumpfschrecke, die Grüne Keiljungfer, den Dukatenfalter, den Hochmoor-Bläuling oder auf Feuchtwiesen im Raum Selb den Abbiß-Scheckenfalter charakterisiert. Eine Besonderheit stellt das einzige in Deutschland bekannte Vorkommen der Krauss‘ Höhlenschrecke (Troglophilus neglectus) in einer Marmorhöhle bei Sinatengrün dar.
Die Flüsse und Bäche des Fichtelgebirges beherbergen u. a. Bachneunauge und Koppe sowie seltene Libellenarten wie grüne und gemeine Keiljungfer. Dem Schutz der letzten Perlmuschelbestände in sauberen und kalkarmen Bächen hoher Gewässergüte (z.B. Steinselb, StMLU 1999) kommt herausragende Bedeutung zu.
411 Mittelvogtländisches Kuppenland
Eine Besonderheit der Fauna des mittelvogtländischen Kuppenlandes ist das landesweit bedeutsame Vorkommen der gefährdeten Flussperlmuschel. Die Gründlandbereiche weisen z. T. noch gute Bestände von Wiesenbrütern, wie z.B. die Bekassine, Braunkehlchen oder Wiesenpieper auf.
412 Oberes Vogtland
In den ausgedehnten Wäldern des Rehauer Forstes treten laut ABSP (StMLU 1994) Kolkrabe, Sperlingskauz, Rauhfußkauz und Schwarzstorch auf.
Mehrere Bäche im Einzugsbereich der Südlichen Regnitz weisen landesweit bedeutsame Vorkommen der Flussperlmuschel auf. Weitere bedrohte Arten der Bäche sind Zweigestreifte Quelljungfer, Gemeine Keiljungfer, Bachhaft, Bachneunauge, Rutte, Edelkrebs sowie der Eisvogel.
Potenzielle Natürliche Vegetation
Die Potenzielle Natürliche Vegetation (PNV) ist ein Konzept, das von Tüxen (1956) entwickelt wurde, um Klimaxgesellschaften anthropogen beeinflusster Standorte zu ermitteln:
"Der früheren realen natürlichen, also der früher tatsächlich vorhanden gewesenen natürlichen Vegetation kann nur ein gedachter natürlicher Zustand der Vegetation gegenübergestellt werden, der sich für heute oder einen bestimmten früheren Zeitabschnitt entwerfen lässt, wenn die menschliche Wirkung unter den heute vorhandenen oder zu jenen Zeiten vorhanden gewesenen übrigen Lebensbedingungen und die natürliche Vegetation, um denkbare Wirkungen sich inzwischen vollziehender Klimaänderungen und ihrer Folgen auszuschließen, sozusagen schlagartig in das neue Gleichgewicht eingeschaltet gedacht würde." Die PNV ist folglich die am weitest entwickelte Vegetationsform (Klimaxgesellschaft), die sich zum jetzigen Zeitpunkt auf einem Standort einstellen könnte. Für die Entwicklung der PNV müssen im Gegensatz zum Konzept der natürlichen Vegetation, bei dem der Mensch niemals eingegriffen hätte, Klima, Geologie, Bodenverhältnisse und historische menschliche Einflüsse (z.B. Bodenversauerung, Streunutzung) berücksichtigt werden. Als Orientierung werden Reste naturnaher Vegetation untersucht. Kowarik (1987) und Härdtle (1995) aktualisierten die Begriffsdefinition und versuchten den Begriff der PNV schärfer zu fassen.
Mit dem Modell der PNV ist es im Naturschutz möglich:
- den Grad der menschlichen Einflussnahme auf die vorhandene Vegetation abzuschätzen (Vergleich reale Vegetation / potenziell natürliche Vegetation);
- Zielvorstellungen naturnaher Waldentwicklung zu formulieren: Forste mit standortfremder Bestockung können durch gezielte Umbaumaßnahmen mit Bezug auf die PNV an Naturnähe gewinnen;
- Standortpotenziale zu sichern: Die PNV beschreibt umfassend das vorhandene Standortpotenzial. Bei der Lebensraumneuanlage und -pflege kann das Standortpotenzial einschließlich der Sonderstandorte durch Förderung der PNV oder deren naturnahen Ersatzgesellschaften gesichert werden.
Bayernweit und auf kleiner Maßstabsebene stellt die von Seibert (1968) erarbeitete Karte der PNV im Maßstab 1:500.000 immer noch die wichtigste flächendeckende Information dar. Sie wird daher herangezogen, die Standorteinheiten der Region Oberfranken-Ost kurz zu charakterisieren und einen Überblick über die möglichen Klimaxgesellschaften des Untersuchungsgebiets zu geben. Da sie nicht mehr den neuesten Erkenntnissen entspricht, wurden Vergleiche zu Untersuchungen von Türk (1993) in Oberfranken und bayernweiten Erhebungen von Walentowski et al. (2001) gezogen, in der nachfolgenden Tabelle als Alternativen genannt.
Im Mittelvogtländischen Kuppenland, das sich in nordöstlicher Richtung an Frankenwald und Münchberger Gneismasse anschließt, setzt sich der nach Nordosten zunehmend waldärmere Landschaftscharakter dieser beiden Naturräume fort. Die Landschaft nördlich von Hof ist geprägt durch intensiven Ackerbau (54,4 %), hinter den andere landwirtschaftliche Nutzungsformen zurücktreten. Wald nimmt nur noch 13,5 % der Fläche dieses Naturraumes in der Region 5 ein.
Naturbetonte Flächen sind in diesem Raum der Region deutlich unterrepräsentiert. Unter den naturnahen Flächen nehmen Feuchtlebensräume wie Hochstaudenbestände (4,6 % der Biotopfläche), Nasswiesen, Flachmoore und Streuwiesen (zusammen 11,3 %) mit zusammen insgesamt 37 % aller amtlich kartierten Biotope ungefähr den gleichen Anteil ein wie mesophile Lebensräume. Hecken (9,7 %) und Feldgehölzen (5 %) kommt in den Ackerfluren als gliedernde Elemente und Rückzugsgebiete für die Fauna eine große Bedeutung zu. Grünlandgeprägt ist z.B. die Aue der Südlichen Regnitz.
Landschaftsbereichernde Strukturen wie Hecken, Gebüsche und Feldgehölze sind laut ABSP (StMLU 1994) häufig auf Bereiche in unmittelbarer Nähe zur ehemaligen DDR-Grenze konzentriert.
412 Oberes Vogtland
Das Obere Vogtland schließt südöstlich an das Mittelvogtländische Kuppenland an. Dieser Naturraum greift nur mit dem Rehauer Forst östlich Rehau in die Region 5 hinein. Der Nadelwald dominiert mit nahezu 80 % das Landschaftsbild. In den Offenlandbereichen herrscht Acker- und Mischnutzung vor.
Über 96 % aller kartierten Biotope in diesem Naturraum sind Feuchtlebensräume. Niedermoor- und Streuwiesenvegetation nimmt alleine 57,7 % der gesamten Biotopfläche ein.
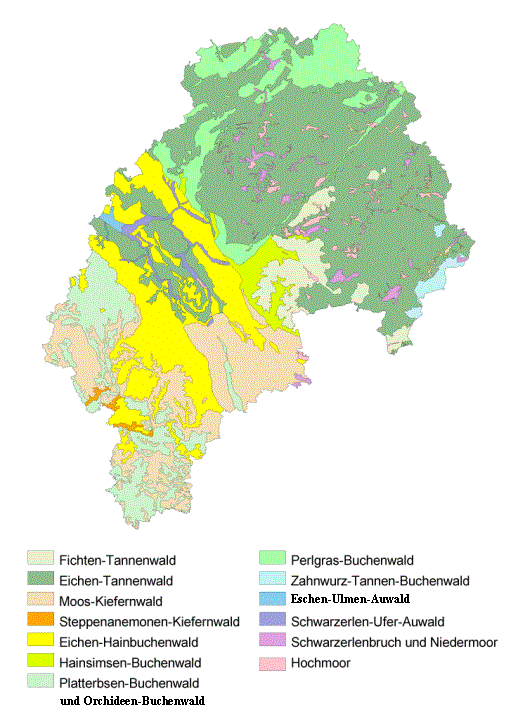 |
Abb. 5:
Potenzielle Natürliche Vegetation in der Region 5, verändert nach Seibert
(1968)
Tab. 4: Potenzielle Natürliche Vegetation (PNV) in der Region Oberfranken-Ost
|
Potenzielle natürliche Vegetation |
Räumliche Verbreitung |
|
Obermainisch-Oberpfälzisches Hügelland: Obermainisches Hügelland, Oberpfälzisches Hügelland |
|
|
Tal- und Auebereiche |
|
|
Eschen-Ulmen-Auwald (Querceto-Ulmetum minoris) (alternativ: Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald; Galio-Carpinetum) |
im Maintal westlich von Kulmbach regelmäßig überschwemmte Talauen größerer Flüsse mit quartären Talfüllungen auf Grund des Ausbaus des Mains bleiben aktuell die Überschwemmungen aus |
|
Schwarzerlen-Ufer-Auwald (Stellario Alnetum) |
Talbereiche des Weißen und des Roten Mains und der Zuflüsse, kleinflächig im gesamten Naturraum vorkommend an den weniger steilen Unter- und Mittelläufen der Bäche, vernässte quartäre Talfüllungen |
|
Eichen-Tannenwald (Vaccinio-Abietum, Hügellandform mit Melampyrum pratense) |
Höhenzug zwischen Rotem und Weißem Main, nordost-exponierte Maintalflanke auf sandig-lehmigen Böden über kristallinen Gesteinen und Tonschiefer |
|
Hainsimsen-Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum luzuletosum, Nordbayern-Rasse) Reiner Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum typicum, Nordbayern-Rasse) |
Verebnungen auf den Höhenzügen zwischen den Talbereichen und in breiten Flusstälern sowie im unteren Bereich der Hanglagen diese Vegetationseinheiten treten gemeinsam und oft in engem Wechsel auf, auf sandigen Lehmen bis Ton |
|
Moos-Kiefernwald (Leucobryo-Pinetum, Peucedano-Pinetum) Preißelbeer-Eichenwald (Vaccinio-Quercetum) |
trockene Talbereiche und Höhenlagen südöstlich Bayreuth, überwiegende potenzielle Vegetationseinheit im Oberpfälzischen Hügelland |
|
Sonderstandorte |
|
|
Platterbsen-Buchenwald (Lathyro-Fagetum typicum) (alternativ: Hordelymo-Fagetum) |
Höhenzug südöstlich von Creußen Lehmig, tonige Böden über Kalkgesteine des Jura |
|
Schwarzerlenbruch (Carici elongatae-Alnetum) |
Verebnungen mit stehendem oder langsam fließendem Grundwasser im Tal der Haidenaab |
|
Hochmoor (Sphagnion fusci) und Kiefernmoore (Vaccinio uliginosi-Pinetum) mit Schlenkengesellschaften |
Verebnungen im Oberpfälzischen Hügelland im Umgriff des Haidenaab-Tals |
|
Nördliche Frankenalb |
|
|
Tal- und Auebereiche |
|
|
Winkelseggen-Erlen-Eschenwald
(Carici remotae-Fraxinetum) Hainsternmieren-Erlenwald (Stellario nemorum-Alnetum) |
kleinflächig an den Oberläufen der Bäche mit steilem Ufer, im gesamten Naturraum vorkommend, wegen der geringen Ausdehnung in der Karte nicht darstellbar kleinflächig an den weniger steilen Unter- und Mittelläufen der Bäche, im gesamten Naturraum vorkommend, wegen der geringen Ausdehnung in der Karte nicht darstellbar |
|
Albanstieg und Hochfläche |
|
|
Moos-Kiefernwald (Leucobryo-Pinetum, Peucedano-Pinetum) Preißelbeer-Eichenwald (Vaccinio-Quercetum) |
Höhenzüge und Albanstieg im Bereich des Veldensteiner Forst, nördlich Pottenstein und südwestlich Hollfeld auf sandigen bis lehmig-sandigen Böden des Doggers |
|
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum typicum, Nordbayern-Rasse) |
Verebnungen auf den Höhenzügen bei Waischenfeld und Pottenstein und am Albanstieg aus dem Maintal auf schluffigen Lehm- bis Tonböden des Lias und des Doggeranstiegs |
|
Wachtelweizen-Platterbsen-Buchenwald (Lathyro-Fagetum melampyrietosum), (alternativ: Hordelymo-Fagetum) Platterbsen-Buchenwald (Lathyro-Fagetum typicum), (alternativ: Hordelymo-Fagetum) Orchideen-Buchenwald (Carici-Fagetum, Mittelgebirgs-Rasse) |
auf Verebnungen der Kuppenalb,
trockene Standorte der lehmigen Albüberdeckung an geneigten, frischen Standorten
des Dolomits und Malms sonnenseitige Hänge am Albanstieg diese Vegetationseinheiten treten auf Grund kleinräumig wechselnder Standortsbedingungen gemeinsam und oft in engem Wechsel nördlich Hollfeld und im Bereich Pottenstein auf |
|
Sonderstandorte |
|
|
Steppenanemonen-Kiefernwald (Anemono-Pinetum) |
Bereich der Kuppenalb zwischen Aufseß und Waischenfeld, um Pottenstein oder Eichenstruth südexponierte Hangfußbereiche der Kuppenalb mit verwitterten Dolomit-Sanden |
|
Thüringisch/Fränkisches Mittelgebirge: Frankenwald, Münchberger Hochfläche, Hohes Fichtelgebirge, Selb-Wunsiedler Hochfläche |
|
|
Tal- und Auebereiche |
|
|
Winkelseggen-Erlen-Eschenwald
(Carici remotae-Fraxinetum) Hainsternmieren-Erlenwald (Stellario nemorum-Alnetum) |
kleinflächig an den Oberläufen der Bäche mit steilem Ufer bei basenreichen Gebieten, im Naturraum eher selten, wegen der geringen Ausdehnung in der Karte nicht darstellbar kleinflächig an den weniger steilen Unter- und Mittelläufen der Bäche, im gesamten Naturraum vorkommend, wegen der geringen Ausdehnung in der Karte nicht darstellbar |
|
Schwarzerlenbruch (Carici elongatae-Alnetum) Niedermoor (Caricion canescenti-fuscae) |
vor allem auf den Hochflächen der Münchberger Hochfläche und des Hohen Fichtelgebirges (selten) Verebnungen mit stehendem oder langsam fließendem Grundwasser über kristallinem Gestein bis 600 m NN |
|
Mittlere und höhere Lagen |
|
|
Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum, Hügelland-Form, Ostbayern-Rasse) |
an den west- und nordwestexponierten Hanglagen und Talflanken des Hohen Fichtelgebirges bis 700 m NN, kleinflächig auch an den Talflanken des Frankenwaldes auf lehmigen Sandböden des Buntsandsteins |
|
Perlgras-Buchenwald (Melico-Fagetum, Frankenwald-Rasse) Labkraut-Buchen-Tannenwald (Galio-Abietum, Frankenwald-Rasse) (alternativ: Waldmeister-Tannen-Buchenwald, Galio odorati-Fagetum) |
tiefgründige Lehmböden mittlerer
Basensättigung höher gelegene tiefgründige,
frische Schluffböden diese Vegetationseinheiten treten gemeinsam und oft in engem Wechsel auf; bis 700m NN an der Südostflanke des Frankenwaldes zur Münchberger Hochfläche |
|
Eichen-Tannenwald (Vaccinio-Abietum, Hügellandform mit Melampyrum pratense) |
häufigste potenzielle Vegetationseinheit nach Seibert (1968) der Höhenlagen des Frankenwaldes, der Münchberger Hochfläche und der Selb-Wunsiedler Hochfläche bis 700 m NN auf sandig-lehmigen Böden über kristallinen Gesteinen und Tonschiefer |
|
Bergland |
|
|
Fichten-Tannenwald (Vaccinio-Abietum,
Bergland-Form mit Bazzania trilobata) (alternativ: Wollreitgras-Fichtenwald, Calamagrostio villosae Piceetum) |
in den Höhenlagen des Hohen Fichtelgebirges zwischen 700 m und 1.050 m (Ochsenkopf, Schneeberg, Großer Kornberg) und auf der Platte in der Selb-Wunsiedler Hochfläche auf geringmächtigen sandigen Lehmen über kristallinen Gesteinen und Blockschuttmeeren |
|
Zahnwurz-Tannen-Buchenwald (Cardamino enneaphylli-Fagetum, Bergland-Form) (alternativ: Hainsimsen-Tannen-Fichten-Buchenwald, Luzulo-Fagetum, Hochlagenform) |
südöstliche Höhenlagen der Selb-Wunsiedler Hochfläche, auf 600 bis 900 m NN (z.B. Ruhberg im Reichswald bei Marktredwitz) auf sandigen Lehmen über basischen Silikatgesteinen |
|
Sonderstandorte |
|
|
Hochmoor (Sphagnion fusci) und Kiefernmoore (Vaccinio uliginosi-Pinetum/Mugetum) mit Schlenkengesellschaften |
vor allem in Mulden der Münchberger Hochfläche und des Hohen Fichtelgebirges Verebnungen des kristallinen Gesteins bis 800 m NN über Hochmoorböden |
|
Moos-Kiefernwald (Leucobryo-Pinetum) Schneeheide-Weißmoos-Kiefernwald (Leucobryo-Pinetum ericetosum herbaceae) Flechten-Weißmoos-Kiefernwald (Leucobryo-Pinetum cladorietosum) Serpentin-Kiefernwald (Erico Pinetum serpentinii) |
vereinzelte Standorte im Frankenwald, der Münchberger Hochfläche und des Fichtelgebirges, i.d.R. kleinflächige Standorte, die nicht dargestellt werden können, z.B. im Bereich sonnenexponierter Felsfreistellungen auf basenarmen, trockenen Schieferverwitterungen bzw. Granitfelsen des Fichtelgebirges Schneeheide-Weißmooskiefernwälder kommen v. a. im Selber Forst und Arzberger Forst vor, die Serpentin-Kiefernwälder entlang des Serpentinzuges der Münchberger Hochfläche von Wurlitz zum Haidberg und in der Verlängerung am Peterleinstein am Fuße des Frankenwaldes |
|
Sächsisches Mittelgebirge: Mittelvogtländisches Kuppenland, Oberes Vogtland, Elstergebirge |
|
|
Perlgras-Buchenwald (Melico-Fagetum, Frankenwald-Rasse) Labkraut-Buchen-Tannenwald (Galio-Abietum, Frankenwald-Rasse) (alternativ: Hainsimsen-Tannen-Buchenwald, Luzulo-Fagetum) |
tiefgründige Lehmböden mittlerer
Basensättigung höher gelegene tiefgründige,
frische Schluffböden diese Vegetationseinheiten treten gemeinsam und oft in engem Wechsel auf; auf 500 bis 600m NN im Mittelvogtländischen Kuppenland |
|
Eichen-Tannenwald (Vaccinio-Abietum, Hügellandform mit Melampyrum pratense) |
Höhenlagen des Mittelvogtländischen Kuppenlands östlich Hof, Oberes Vogtland auf 500 bis 600 m NN auf sandig-lehmigen Böden über kristallinen Gesteinen und Tonschiefer |
|
Schwarzerlenbruch (Carici elongatae-Alnetum) |
flache Talbereiche der Regnitz östlich Hof stehendes, langsam fließendes Grundwasser über kristallinem Gestein bis 600 m NN |
|
Hochmoor (Sphagnion fusci) und Kiefernmoore (Vaccinio uliginosi-Pinetum/Mugetum) mit Schlenkengesellschaften |
Hochflächen des Oberen Vogtlands Verebnungen des kristallinen Gesteins bis 650 m NN über Hochmoorböden |
|
Moos-Kiefernwald (Leucobryo-Pinetum) |
vereinzelte Standorte im Oberen Vogtland im Bereich sonnenexponierter, basenarmer Urgesteinsstandorte |